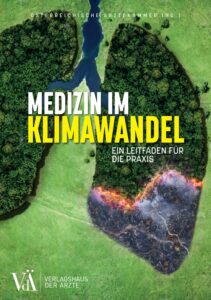Die Gesundheits- und Krankenpflege spielt als größte Berufsgruppe im Gesundheitssektor eine zentrale Rolle im Hinblick auf Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen. Pflegekräfte erleben aus erster Hand die schädlichen Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit der Bevölkerung, vor allem der vulnerabelsten Gruppen. Sie haben darüber hinaus auch die Möglichkeit, Entscheidungen an ihrem Arbeitsplatz direkt zu beeinflussen und sich für Veränderungen einzusetzen, die zur dringend notwendigen Reduktion des CO2-Fußabdrucks des Gesundheitssystems beitragen.
Klimabezogene Aktivitäten stärken
Im Gegensatz zu Österreich ist in den englischsprachigen Ländern das Thema Klimawandel in der Pflege schon lange angekommen, auch in der Ausbildung. Trotzdem zeigen Umfragen auch dort, dass es an Wissen um die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Gesundheit und damit an eigenen Ressourcen zur Platzierung des Themas fehlt. Cook et al.86 nennen zusätzlich Zeitmangel, konkurrierende Prioritäten am Arbeitsplatz sowie mangelnde institutionelle Unterstützung als Barrieren zur Auseinandersetzung mit dem Thema. Um in Zukunft diese Berufsgruppe in der Übernahme klimabezogener Aktivitäten zu stärken und innerinstitutionelle Veränderungen voranzutreiben, schlagen Butterfield et al.87 unter anderem vor,
- der Pflege eine Führungsrolle in Bezug auf Klimaschutz/-anpassung innerhalb der eigenen Institution zu geben,
- verpflichtende Aus- und Weiterbildung einzuführen und
- individuelles Engagement zu fördern.
Anpassung an Hitzebelastungen
In Österreich, wie auch in Deutschland, werden in Bezug auf die Pflege bisher primär die Auswirkungen von Hitze und die damit notwendigen Klimaanpassungsmaßnahmen thematisiert. Hitzebelastungen stellen bereits jetzt eine große Herausforderung für Gesundheits- und Pflegeinrichtungen dar. Besonders betroffen sind ältere, kranke oder pflegebedürftige Menschen, aber auch die Beschäftigten in der Pflege selber, da längst nicht alle Einrichtungen mit Klimaanlagen ausgerüstet bzw. baulich angepasst sind. Pflegekräfte sind somit in dreifacher Hinsicht gefordert:88, 89
- Im Rahmen der Patient*innen- und Angehörigen-Edukation: Thematisierung der Auswirkungen hoher Temperaturen auf Blutdruck, Flüssigkeitshaushalt, Wundinfektion, bestimmte Krankheitsbilder (v. a. neurologische Erkrankungen) sowie die Lagerung und Einnahme von Medikamenten und der Umgang mit transdermalen therapeutischen Systemen;
- Zum Schutz der Patient*innen Umsetzung von Hitzeanpassungsmaßnahmen: verstärkte Krankenbeobachtung und Vitalzeichenkontrolle; Flüssigkeitsbilanzierung; Sturzprophylaxe aufgrund möglicher Kreislaufprobleme; vermehrte Grund- und Hautpflege; häufigerer Wäschewechsel; Schaffung eines angenehmen Zimmerklimas;
- Zum Selbstschutz im Sinne des Erhalts der eigenen Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit: Einführen zusätzlicher (Trink-)Pausen, Kleidungswechsel bei starkem Schwitzen, Verlagern körperlich anstrengender Tätigkeiten in Morgen- und Abendstunden (wenn möglich), Achten auf Raumtemperatur.
Nachhaltiges Gesundheitssystem
Pflegekräften kommt aber auch eine zentrale Rolle in Bezug auf den Klimaschutz zu. Sie können auf der einen Seite Patientinnen zu einem gesundheitsförderlicheren und damit in Folge klimafreundlicheren Verhalten motivieren (beispielsweise in Bezug auf Ernährung und Bewegung) und auf der anderen Seite an ihrem Arbeitsplatz Klimaschutzmaßnahmen selbst umsetzen bzw. das Thema mit ihren Führungskräften und der Unternehmensleitung aufgreifen und so zu einem nachhaltigeren Gesundheitssystem beitragen. Letzteres umfasst laut Cook et al.86:
- Einführung effizienterer Betriebsabläufe, um durch automatische Heiz- und Kühlprozesse Energie zu sparen;
- Umstellung auf ein gesundes Ernährungssystem (im Sinne der Planetary Health Diet) und Lebensmittel aus lokalem Anbau mit möglichst wenig Verpackung;
- Nutzung weniger giftiger Chemikalien und Reinigungsprodukte;
- Vermeidung/Reduktion medizinischer Abfälle sowie Regelung der Abfallentsorgung insbesondere gefährlicher Stoffe, Arzneimittel, Betäubungsmittel und infektiöser Abfälle.
Um in Zukunft klimawandelrelevante Veränderungen sowohl in Hinsicht auf das individuelle wie organisationale Verhalten in die Umsetzung zu bringen, müssen Ärzte und Pflegekräfte eng miteinander kooperieren. Überraschenderweise wird dem in der Literatur jedoch keine Rechnung getragen. Es muss also davon ausgegangen werden, dass es nicht nur an einem Verständnis der Auswirkungen des Klimawandels auf die Arbeit der jeweils andere Berufsgruppe mangelt, sondern auch keine Synergien im gemeinsamen Handeln zum Schutz des Klimas entstehen. Auch stellt sich die Frage, welche der beiden Berufsgruppen für eine „Klima-Gesundheitsberatung“ von Patienten und Angehörigen zuständig ist.
Neue Versorgungsformen
Der Ruf nach neuen Versorgungsformen in Österreich und die in diesem Zusammenhang diskutierten neuen Berufsfelder in der Pflege könnten hier vielversprechende Wege eröffnen. Eine wohnortnahe Patientinnenbetreuung, wie sie im Rahmen von Primärversorgungseinheiten modellhaft in Österreich zurzeit implementiert wird, würde es den dort tätigen Berufsgruppen ermöglichen, organisationale und strukturelle Ressourcen im Sinne des Klimaschutzes gemeinsam zu nutzen, sowie „Klima-Gesundheitssprechstunden“ für Patienten einzuführen.
Ähnlich verhält es sich in Bezug auf das Pilotprojekt „Community Health Nurses“. Als zentrale Ansprechperson vor Ort sollen Community Health Nurses pflegerische Leistungen und Leistungsanbieterinnen koordinieren, eine reibungslose Versorgung gewährleisten sowie präventiv tätig werden, um die Gesundheitskompetenz und das Wohlbefinden der Bevölkerung in der Gemeinde zu stärken. Durch diese Schnittstellenfunktion ist davon auszugehen, dass auch hier Ressourcen von Ärztinnen und Pflegekräften besser koordiniert werden können – mit positiven Auswirkungen auf Klimaschutz wie Klimaanpassung. In all diesen zukunftsgerichteten Projekten müsste jedoch ökologische Nachhaltigkeit von Anfang an mitgedacht werden, da nur so ein Bewusstsein für die Co-Benefits zwischen Klima und Gesundheit geschaffen und die notwendige „Climate Health Literacy“ langfristig bei allen Beteiligten aufgebaut werden kann.